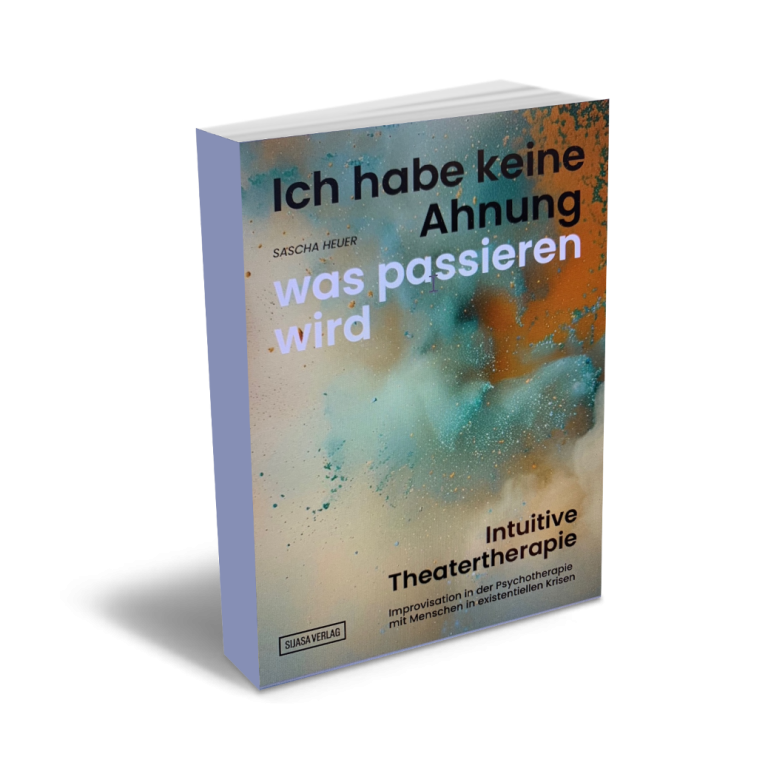Der Impuls
„Die Wahrheit liegt auf dem Platz!“ soll Sepp Herberger, der Nationaltrainer der Fußball-Weltmeistermannschaft von 1954 gesagt haben. Ich glaube, er wollte damit sagen, im Fußball zeigt sich alles letztendlich erst in der Spielsituation. Training, mentale Vorbereitung, gute Ernährung, richtige Schuhwahl, alles dieses hilft, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Entscheidend ist aber das Verhalten in der konkreten Situation. Wie reagiert ein Spieler, wenn er es mit einem physisch überlegenen Gegenspieler zu tun hat? Kann er den entscheidenden Pass genau in diesem Augenblick mit der richtigen Geschwindigkeit und der exakten Richtung spielen, wenn seine Mannschaft in einem wichtigen Spiel im Rückstand liegt? Wie verhält er sich bei kaltem Regen, wie bei stechender Hitze, wie bei fünfzigtausend Zuschauern, die ihn auspfeifen?
Die Struktur des Spiels beim Fußball ist im Vergleich zu anderen Sportarten erstaunlich offen. Es gibt zwar Regeln, was erlaubt und was verboten ist. Aber letztlich ist es offen, was bei einem Fußballspiel passiert. Es ist theoretisch möglich, dass ein Spieler neunzig Minuten mit dem Ball am Fuß kreuz und quer über den Platz läuft. In der Praxis passiert das natürlich nicht. Interessant ist aber: Fußball ist eine Sportart, die komplexe Anforderungen an die Intuition stellt.
Und damit sind wir bei der Parallele zur Theatertherapie.
Ich habe mir für die Theatertherapie - Gruppe eine Taktik zurechtgelegt, mich auf die einzelnen Gruppenteilnehmer vorbereitet und manchmal therapeutische Überlegungen zu Methode und Verfahren angestellt– früher mehr, heutzutage weniger. Aber dann kommen die Gruppenteilnehmer in den Raum. Und ebenso wie man nie weiß, welche Bedingungen bei einem Fußballspiel genau herrschen werden, ist es in der Therapiesituation auch.
Wie gehen wir mit dem schrecklichen Traum von Patient A in der letzten Nacht um?
Will Patient B den gesponnenen Faden der letzten Therapiestunde weiter spinnen? Oder will er nicht, hat er den Faden vielleicht schon wieder abgeschnitten und in den Müll geworfen? Wenn ja, wie verhalte ich mich dazu?
Was ist mit der heutigen Unruhe von Patient C?
Patient D bleibt in der Anfangsrunde zurückhaltender als sonst, lasse ich ihn in der Reserve?
„Die Wahrheit liegt auf dem Platz“ heißt für mich: ich muss wie ein Fußballer permanent Entscheidungen treffen. Und zwar Entscheidungen aus dem Moment heraus. Ich habe nicht Zeit für eine ruhige Reflexion (erst später bei der Einordnung in den gesamten Prozess). Nein, ich muss die Entscheidungen jetzt treffen. Aus mir heraus. Es ist dabei eine Qualität gefordert, die man Instinkt oder Intuition nennen kann. Ich habe sie für mich als Fußballer gelernt und später durch Therapie, Theater und berufliche Praxis verfeinert.
Wenn ich eine spielerische Atmosphäre in der Therapie kreiere, wird damit der Instinkt bei den Gruppenteilnehmern wachgerufen. Es geht damit automatisch ein Freilegen der Intuitionsfähigkeit einher. Je freier sich ein Mensch fühlt, je mehr die innere Erlaubnis wächst, desto mehr bekommt er wieder Zugang zu seinen Instinkten, seiner Intuition oder seinen Impuls. Ist der Geist des Instinktes in einer Gruppe und in den einzelnen Patienten wachgerufen, ergeben sich erheblich größere Möglichkeiten, sich dem zu nähern, was der Patient tief in sich als eigene Problemlösung mit sich herumträgt.
Die bereits zitierte Frau U. meint dazu:
„In der Theatertherapie weiß man zu Beginn der Stunde nicht, was am Ende herauskommt. Der Verlauf ist nicht plan- oder vorhersehbar. Ich höre in mich hinein und handele intuitiv, so wie ich meine, dass es für mich authentisch ist.“
Dieser Zugang zur Intuition kann nur freigelegt werden, wenn ich selber mich auch so durch die Gruppe bewege.
Kommen wir als Beispiel nochmal zur Anfangssituation bei Herrn A. im letzten Kapitel zurück.
Er schildert zu Beginn seiner zweiten Gruppenstunde seinen inneren Druck. Da ich Herrn A. zu diesem Zeitpunkt kaum kenne, kann ich auch noch gar keinen Plan haben, was wir zusammen machen könnten. Aus seiner Beschreibung entsteht in mir ein grobes Gefühl „Okay, damit könnten wir irgendwie spielerisch starten.“, was sich bei Patienten, die nicht gerade total unter Spannung stehen, für den Einstieg meistens gut eignet. Ich teile Herrn A. das auch so mit. Er willigt ein.
Ich sage der Gruppe, dass alle, die Lust haben, an dem gleich stattfindenden Spiel teilnehmen können. In diesem Moment weiß ich aber noch nicht, was wir konkret machen werden. Ich habe einige Standardspiele, die ich für verschiedene Situationen einsetze. In diesem Moment kommt mir davon aber keines in den Sinn. Also gehe ich einfach mit meiner Energie und vertraue darauf, dass die Dinge sich schon fügen werden.
Im Gruppenraum befinden sich eine ganz Reihe von Gegenständen, die hauptsächlich für die ebenfalls in diesem Raum stattfindende Bewegungstherapie angeschafft wurden. Ich gehe zu der Seite des Raumes, in der sich Bälle, Matten, Stöcke etc. befinden. Ich bekomme eine Ahnung davon, irgendeinen Wettkampf zu veranstalten. Auf dem Weg zu den Gegenständen komme ich bei Frau H. vorbei, die noch neu in der Gruppe und ängstlich ist. Sie fragt mich, was das denn für ein Spiel sei. Wenn sie das wüsste, könne sie besser entscheiden, ob sie sich darauf einlassen könne. Ich sage ihr, dass ich noch nicht wisse, was wir spielen werden. Bei den Gegenständen angekommen, nehme ich einfach die, die mich gerade ansprechen. Dabei geht mir eine Idee durch den Kopf für ein Konstruktionsspiel, dass ich so ähnlich vor einiger Zeit mit einer anderen Gruppe gespielt habe. Aber da waren es nur drei Patienten, die mitmachten. Jetzt scheinen es mindestens sieben zu sein, Dafür sind dort zu wenige Materialien. Also weiß ich immer noch nicht, was wir machen. Ich nehme nun eine dicke Faszien - Rolle in die Hand und sehe gleichzeitig die weichen formbaren Plastikbälle und – blink – ist die Idee zu dem schon beschriebenen Hockey-Slalomspiel da.
Die Patienten erleben mich also als gegenwärtig, als aus meinen Impulsen agierend. Dieses lädt sie ein, sich ebenfalls in dieser Art zu verhalten. Wir schaffen so einen Raum der wechselseitigen Gegenwärtigkeit – ein hohes Maß an im Hier-und-Jetzt-Sein. Allein das erweckt bei vielen Patienten eine heilsame Kraft, da es für viele von ihnen aufgrund der schwierigen Lebensumstände und/oder -gefühle zuletzt schwer erträglich war, gegenwärtig zu sein. Die seelischen Schmerzen waren meistens zu groß. Das „Nicht-im-Hier-und-Jetzt-Sein“ war zumeist erträglicher oder manchmal sogar der einzige Ausweg. Erleben sie nun in der Theatertherapie wieder das Grundgefühl von Gegenwärtigkeit, bedeutet das auch, sie können überhaupt wieder „da sein“. Dieses fühlt sich per se gut an und ist oft die Voraussetzung für die Arbeit an den „schwierigen“ Themen.