Zuschauen und Mitspielen
Wo es einen Bühnenraum gibt, sind meistens auch Zuschauer dabei. In der Theatertherapiegruppe entsteht permanent die Situation, dass es handelnde Akteure und passive Betrachter gibt. Diese spezielle Rolle des Zuschauens im therapeutischen Prozess braucht eine eigene Betrachtung.
Zunächst sei erwähnt, dass die Unterscheidung in aktive und passive Gruppenteilnehmer gute Differenzierungsmöglichkeiten bietet. Gerade neue Patient*innen genießen in der Rolle des Zuschauers einen Schutzraum, der es ihnen ermöglicht, in der Gruppe anzukommen. Sie lernen die Gruppe, mich und die Theatertherapie kennen und können selber für sich entscheiden, wann sie von der passiven in die aktive Rolle überwechseln. Auch innerhalb des weiteren therapeutischen Verlaufs findet dieser Prozess permanent statt. Immer wieder, zu Beginn jeder Gruppe, sind die Patient*innen im Zusammenspiel mit mir herausgefordert, zu entscheiden, ob sie sich heute Raum nehmen oder nicht, ob es für sie stimmig ist, heute einen weiteren Schritt auf ihrem Weg zu wagen.
Der Zuschauer ist aber nur in dem Sinne passiv, dass er nicht aktiv in das Geschehen eingreift. Innerlich ist er in der Regel sehr aktiv am Geschehen beteiligt. Er nimmt meistens intensiven Anteil an den Darstellungen und Konflikten auf der Bühne (die keine Bühne ist, sondern „nur“ der Platz im Raum, wo gespielt wird). Wie im wirklichen (guten) Theater oder im Kino löst das Geschehen etwas in ihm aus, zumal die dargestellten Situationen oder Konflikte ihm oft bekannt sind. Nicht selten findet eine solch intensive Berührung statt, dass daraus ein eigenes therapeutisches Thema entsteht.
Das Miterleben ermöglicht es dem Zuschauer aber auch, den Prozess der Protagonisten aktiv zu unterstützen. Häufig beziehe ich die Zuschauer in den Prozess mit ein. Gerade zu Beginn, wenn wir uns an einen Konflikt herantasten, sind die Wahrnehmungen und Gefühle der Zuschauer sehr wichtig. Über sie kann der Protagonist eine bessere Einschätzung oder Orientierung einer Situation bekommen.
Meistens spielen auch einige der zuschauenden Patienten mit. Sie übernehmen Rollen, die für die Szene oder das Bild gebraucht werden. Manchmal ist es ja auch gut, wenn der Protagonist zunächst selber Betrachter „seines“ Themas ist. Die Zuschauer kommen hierbei in eine aktive Position und können durch ihr Rollenerleben wertvolle Hinweise für den therapeutischen Prozess geben. Hierbei kann natürlich auch wieder eine eigene Berührung losgehen. Nicht selten werden Zuschauer durch den Protagonisten mit einer Rolle besetzt, die sie selber zentral an sehr wichtige Punkte ihres eigenen therapeutischen Prozesses führen.
Auf den ich aber meistens erst nach der Arbeit mit dem Protagonisten eingehe.
Dieses „Mitspielen“ wird von den Patienten vielfältig erlebt. Für manche ist es nett, schön, bereichernd oder auch lösend. Für andere ist es herausfordernd, schwierig und belastend. Manchmal ist es auch eine Überforderung. Dann kann es ein wichtiger Teil des therapeutischen Prozesses sein, hier seine eigenen Grenzen wahrzunehmen und sich zu trauen, diese zu benennen.
Die allermeisten Patient*innen haben aber trotz der eigenen Belastung genügend innere Kapazitäten, um als Mitspieler*innen auf der Bühne mitzuwirken. Dieses macht etwas mit den einzelnen Menschen und der Gruppensituation im allgemeinen.
Der Mensch erlebt sich in der Regel in den Rollen auf der Bühne stärker, kräftiger, vielfältiger und damit lebendiger als sonst. Es wird ihm/ihr deutlich, dass viel mehr in ihm/ihr steckt, als vermutet. Herr W. beschreibt seine Erfahrungen als Mitspieler wie folgt:
„Die wichtigsten Erlebnisse waren tatsächlich die, in denen ich nicht selbst gearbeitet habe, sondern stellvertretend Rollen für Mitspieler*innen übernommen habe. Allesamt waren dies Situationen, in denen ich in eine Energie gekommen bin, die üblicherweise in meinem Alltag nicht zum Vorschein kommt. Situationen, in denen ich plötzlich stark sein konnte, in denen ich laut werden konnte oder in denen ich auf Reize und Situationen so reagieren konnte, wie ich es üblicherweise nicht kann. Das hat mir gezeigt, dass diese Dinge auch in mir sind und ich vielleicht nur einen Weg finden muss, diese im Alltag abrufen zu können.“
Diese Einschätzung von Herrn W. hat mich überrascht, da er vielfältige Erfahrungen mit der Theatertherapie gemacht hat und dabei auch oft selber ein eigenes Thema auf der Bühne gebracht hatte.
„Das Arbeiten in der Theatertherapie kann mitunter sehr intensiv werden“, sagt er, „was aber für mich durch den geschützten Raum und die Gruppendynamik häufig gut aufgefangen werden konnte. Für mich war es eine gute Möglichkeit, sich mit schweren Themen auseinanderzusetzen ohne Gefahr zu laufen, in einen emotionalen Krisenzustand abzurutschen.“
Mit der Arbeit an diesem Buch habe ich PatientInnen gebeten, ihren theatertherapeutischen Prozess zu reflektieren (siehe Kapitel 16). Damit entsteht die Möglichkeit, noch etwas genauer auf die Wirkfaktoren zu schauen. Im Statement von Herrn W. wird dadurch deutlich, welch große Rolle das Mitspielen einnehmen kann. Er, der wirklich intensiv an eigenen Themen in der Gruppe bearbeitet hat, schätzt das Mitspielen als noch wichtiger für seinen eigenen Prozess ein.
Patient*innen erleben dabei nicht nur das Prinzip „Wir dürfen auch Spaß haben“, sondern auch „Wir erleben uns permanent in unserer Kompetenz“. Wenn ich auf der Bühne stehe und den Anteil der Wut, der Trauer, der Abspaltung, der Mutter oder des Chefs darstelle, erlebe ich mich als produktiv handelnd, meine Fähigkeiten erweiternd und etwas Gutes machend (den Prozess meines Mitpatienten unterstützend).
Es wird hier erahnbar, welche heilenden Kräfte über das Spiel entwickelt werden können.
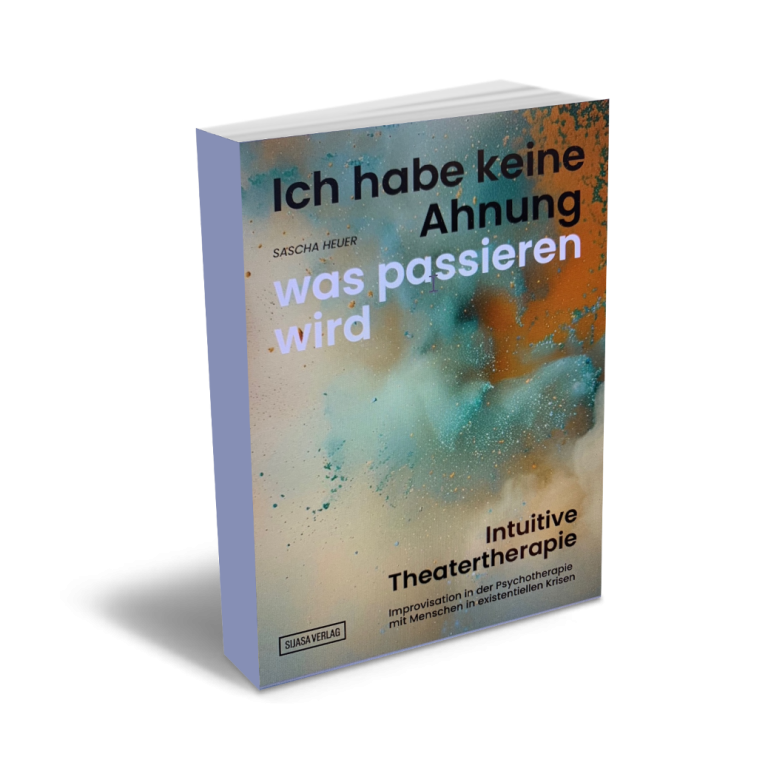
Setzen Sie Ihren Blick ins Buch fort...
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.

